Sleepless in Zurich
Liebeskummer im Mittelalter und heute

Es ist 00:41 Uhr.
Ich kann nicht einschlafen und habe alle Einschlafstrategien durchprobiert – mein Kissen umdrehen, aufs Klo gehen, oder versuchen, nicht einzuschlafen (das funktioniert erstaunlich oft).
Aber da liege ich, hellwach, mit Herzschmerz, der nicht mein eigener ist.
Meine Grossmutter und ich haben uns einen Liebesfilm angeschaut. Nach dem Happy End lief im Abspann das Lied: «But I can’t help falling in love with you.
Tränen liefen meiner Grossmutter über die Wange. Sie musste mir nichts erklären, mein Herz schmerzte mit. Mit brüchiger Stimme sagte sie: «Jetzt ist es halt vorbei.»
Wir alle begegnen Liebeskummer. In persönlichen Erlebnissen und in den Geschichten anderer. Und was wäre die Kunst ohne die unerfüllte Liebe?
Auf der Suche nach dem Zusammenhang zwischen Liebe und Leid, zwischen Kunst und Liebeskummer gehe ich auf eine Reise, die bei einem Gedicht des Zürcher Minnesängers Johannes Hadlaub aus dem Mittelalter beginnt und ins 21. Jahrhundert zum Dokumentarfilm von Christian Frei über Liebeskummer in New York führt.
Ob vor siebenhundert Jahren in Zürich oder im Jahre 2014 in New York – immer wird geliebt und nicht immer geht alles glatt.


Liebeskummer im Mittelalter

Zürich um 1300. Wie sich damals Grossmutter und Enkelin über Liebe verständigten, wissen wir nicht, aber Liebeskummer wurde in zahlreichen Minneliedern besungen. Die Klage um die unerfüllte Liebe und das damit verbundene Leid ist sogar zu einem literarischen Konzept geworden, das man Hohe Minne nennt. Bei der Hohen Minne wirbt ein Mann um eine adelige Dame, die er allerdings nie erreichen kann – weil sie die Liebe nicht erwidert; oft verbieten dies Standesunterschiede. Das Ich, welches im Minnelied spricht, nimmt somit konventionell die Rolle eines unglücklich Verliebten ein.
Zahlreiche solcher Minnelieder sind im Codex Manesse zu finden, der umfangreichsten deutschsprachigen Liederhandschrift aus dem Mittelalter. Der Codex Manesse entstand um 1300 im Auftrag der reichen Familie Manesse aus Zürich. Sie wollten den Minnesang wieder aufleben lassen, da diese Kunstform anfangs 14. Jahrhundert allmählich im Schwinden begriffen war. Ausserdem konnte die Familie Manesse mit einer so prächtigen Handschrift sich selber repräsentieren und demonstrieren, dass sie zu der sozialen Elite gehörten, die sich mit «Vollzugsformen der höfischen Crème wie z.B. Turnier, Jagd, Falkenbeize» und eben auch Minnesang beschäftigen konnten (Schiendorfer 187). So liess Rüdiger Manesse eine Sammlung von Gedichten verschiedenster Autoren anlegen.
Die Meisterleistung: 426 Pergamentseiten im Grossformat (35,5x25cm)! Neben den Gedichten beinhaltet die Handschrift auch 138 ganzseitige Bilder, auf denen jeweils der Autor oder eine Szene aus einem Gedicht illustriert wurde.
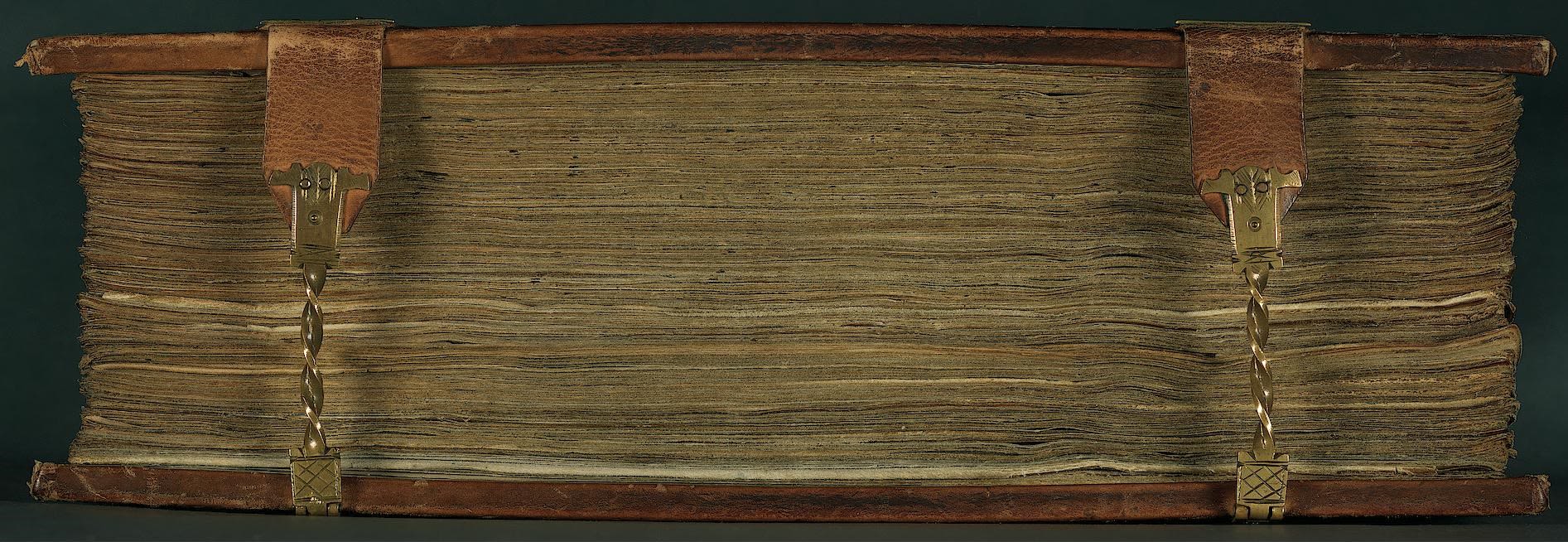
Codex Manesse
Codex Manesse
In dieser Handschrift finden wir Lieder des Zürcher Minnesänger Johannes Hadlaub, der Liebeskummer besonders zum Ausdruck bringt. Durch einen Eintrag im Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich weiss man, dass Hadlaub am 4. Januar 1302 ein Haus im Neumarktquartier gekauft hatte, was die räumliche und zeitliche Nähe zu den Manesse bezeugt. Man geht davon aus, dass er die Familie Manesse persönlich kannte und vielleicht sogar bei der Herstellung der Liederhandschrift mitwirkte.
In seinen Liedern nimmt Hadlaub immer wieder die Rolle des unglücklich Verliebten ein und beklagt sein Leid, das ihm die unerfüllte Liebe verursacht.
Werfen wir einen Blick in die Manessische Liederhandschrift und schauen wir uns Hadlaubs erstes Gedicht an.
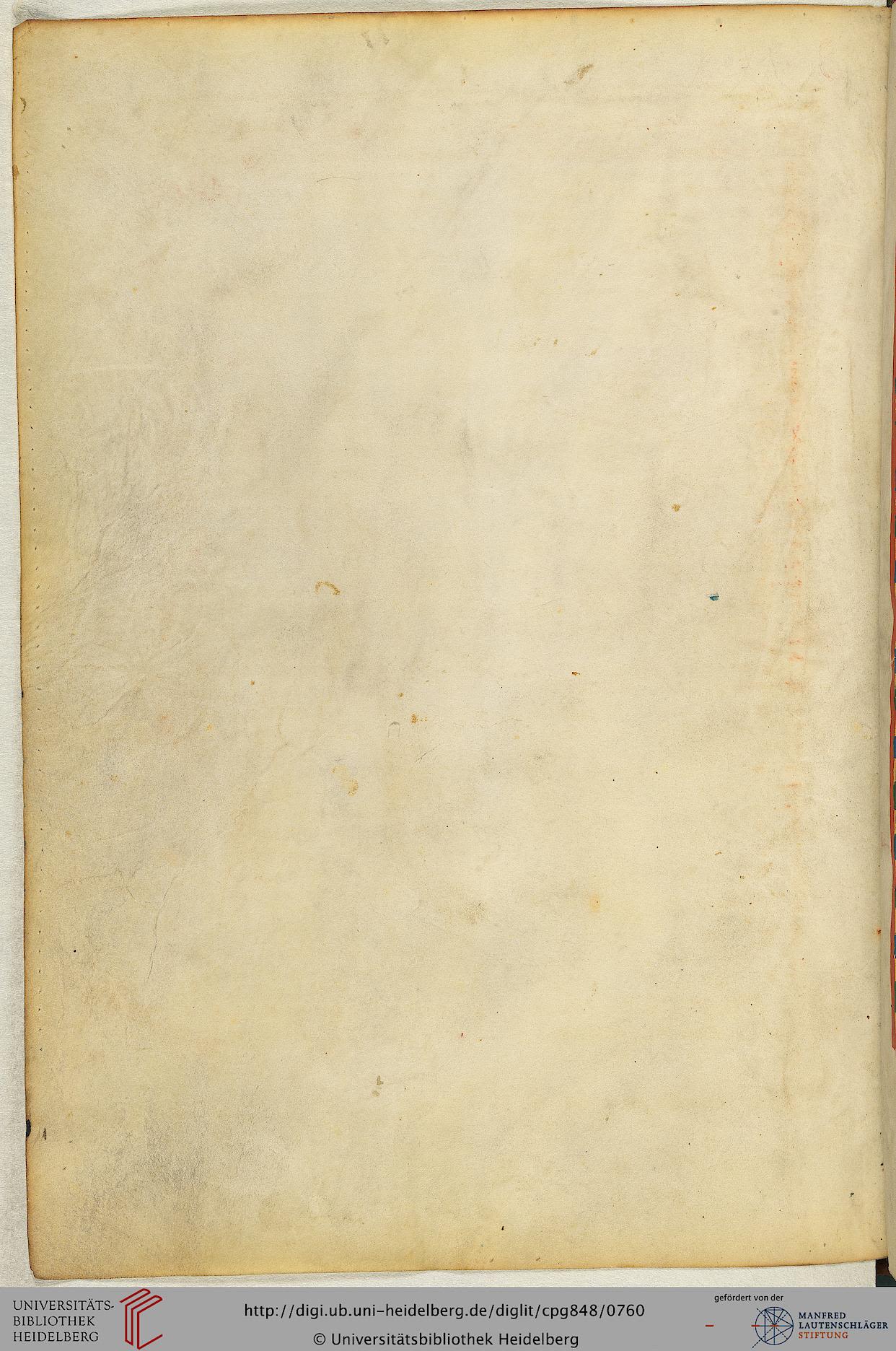
Die wunderschöne Illumination mit den zwei Bildregistern und die aufwändig gestaltete Initiale machen deutlich: Hadlaub hat eine Sonderstellung in der Liederhandschrift.
Seine Initiale ist die kunstvollste und grösste Filigraninitiale im ganzen Codex. Überdies wurden seine Lieder von einer anscheinend exklusiv für ihn bestimmten Schreiberhand niedergeschrieben. Dies hebt Hadlaubs Lieder sogar von denjenigen des Kaisers und der Könige und Herzoge ab, welche – ihrem sozialen Rang gemäss – die ersten Seiten des Codex füllen.
Hadlaub und der Herzschmerz
Ach, mir was lange
Nach ir so wê gesîn
So beginnt Hadlaubs erstes Lied. Es bringt die Sehnsucht des Sprechers nach einer Dame zum Ausdruck: «Ach, mir war lange nach ihr so weh gewesen» (Übersetzung hier und im Folgenden nach Max Schiendorfer). Ihn plagt schon lange ein unerfülltes Verlangen nach ihr, also unternimmt er etwas:
Ich na mir achte
in gewande als ein pilgerîn,
so ich heinlîchste machte,
do sî gieng von mettîn.
Verkleidet als ein Pilger beobachtet er sie heimlich, wie sie von der Frühmesse kommt. Diese Szene wird in der unteren Miniatur dargestellt. Der Glöckner im Kirchenturm auf der rechten Seite läutet zur Messe und eine Nonne betritt gerade die Kirche. Dass die Szene zeitlich vor der Messe geschieht, ist eine kleine Abweichung vom Gedicht, wahrscheinlich weil dem Maler die Bildkomposition so besser gefiel.
Auf der Miniatur sehen wir den Dichter mit einem Wallstab, mit dem Pilger wilde Tiere auf Überlandreisen abwehrten. Besonders aber zeichnen ihn die drei Muscheln am Hut als Pilger aus. Damals galt die Muschel als Symbol für den bedeutendsten Wallfahrtsort, Santiago de Compostela in Spanien. Aus Zinn, Blei oder auch Silber und Gold wurden solche Pilgerzeichen gegossen und als Beweis für die gemachte Wallfahrt angenäht oder -gesteckt. Doch was macht der Pilger da?
Dô hâte ich von sender klāge
einen brief, da an ein angil
den hieng ich an sî
Aus Sehnsucht heftet er einen Brief mit einem Angelhaken an ihr Gewand, ohne dass es jemand bemerken sollte.
Er beobachtet ihre Reaktion: Sie erschrickt, sagt aber nichts wegen ihrem Ruf und verlässt ihn eiligst. Auf dem Bild sieht man ihr den Schrecken nicht an, aber das Hündchen in ihren Armen – von dem im Gedicht eigentlich nichts steht – bellt den verkleideten Dichter an, was die eigentliche Gemütslage der Dame verrät.
Wie si im do tæte,
des wart mir nit geseit,
ob si in hinwurfe ald hæte.
daz tuot mir sende leit.
Was sie mit dem Brief tut, ob sie ihn behält oder wegwirft, erfährt der Sänger – und somit auch die Leserin – nie. Dies bereitet ihm grossen Liebeskummer. Er traut sich nicht, einen Boten zu senden, der ihr von seinem Liebeskummer berichten könnte. Ist die Liebe ein Kommunikationsproblem? Klar ist nur: Seine Liebe bleibt unerfüllt. In den übrigen Strophen jammert er über den Herzschmerz:
ôwê, reine minnekliche,
du tuost mich sêre wunt.
[…] Mîn herze sêre
si mir durbrochen hât,
[…] warumbe tuot si daz?
«Oh weh, du Reine, Liebenswerte, du verwundest mich schmerzlich [...] Mein Herz hat sie mir schmerzlich durchbrochen [...] Warum tut sie das?» Er scheint sich regelrecht in seinen Liebeskummer hineinzusteigern. Sie zeigt ihm die kalte Schulter, aber das heizt die Sache eher noch an.
Mich dunket, man sæhe
mîn frowen wolgetân,
der mir mîn brust ûf bræhe,
in mînem herzen stân.
«Ich glaube, man sähe
Meine wohlgeschaffene Herrin,
wenn man mir die Brust aufbräche,
in meinem Herzen stehen.»




Ob es sich bei Hadlaubs Lied um einen authentischen Ausdruck von Liebeskummer handelt, können wir nicht wissen. Die Germanistik geht nicht davon aus, aber Gottfried Keller, der eine Novelle über Hadlaub schrieb, sehr wohl. So schreibt Keller, dass die Frau vor der Kirche Hadlaub «erfüllte und zugleich sehr schnell sein Herz beschwerte mit einem gelinden Kummer, der seinem Alter sonst auch in Liebessachen nicht eigen war».
Max Schiendorfer, Minnesang- und Hadlaubexperte, betont, dass es gut möglich ist, dass sich das Liebesverhältnis «in Tat und Wahrheit nur auf dem Pergament bzw. auf der Bühne abgespielt hat und daẞ der Dichter sich und seinem erlauchten Publikum damit eine Art fiktiven Rollenspiels auf den Leib schneidern wollte.» (216)
Schiendorfer hat auch dafür gesorgt, dass wir die volle künstlerische Gestalt dieses Liedes erleben können. Die Tonaufnahme von Max Schiendorfer, gibt einen Eindruck von der musikalischen Inszenierung des Liedes.
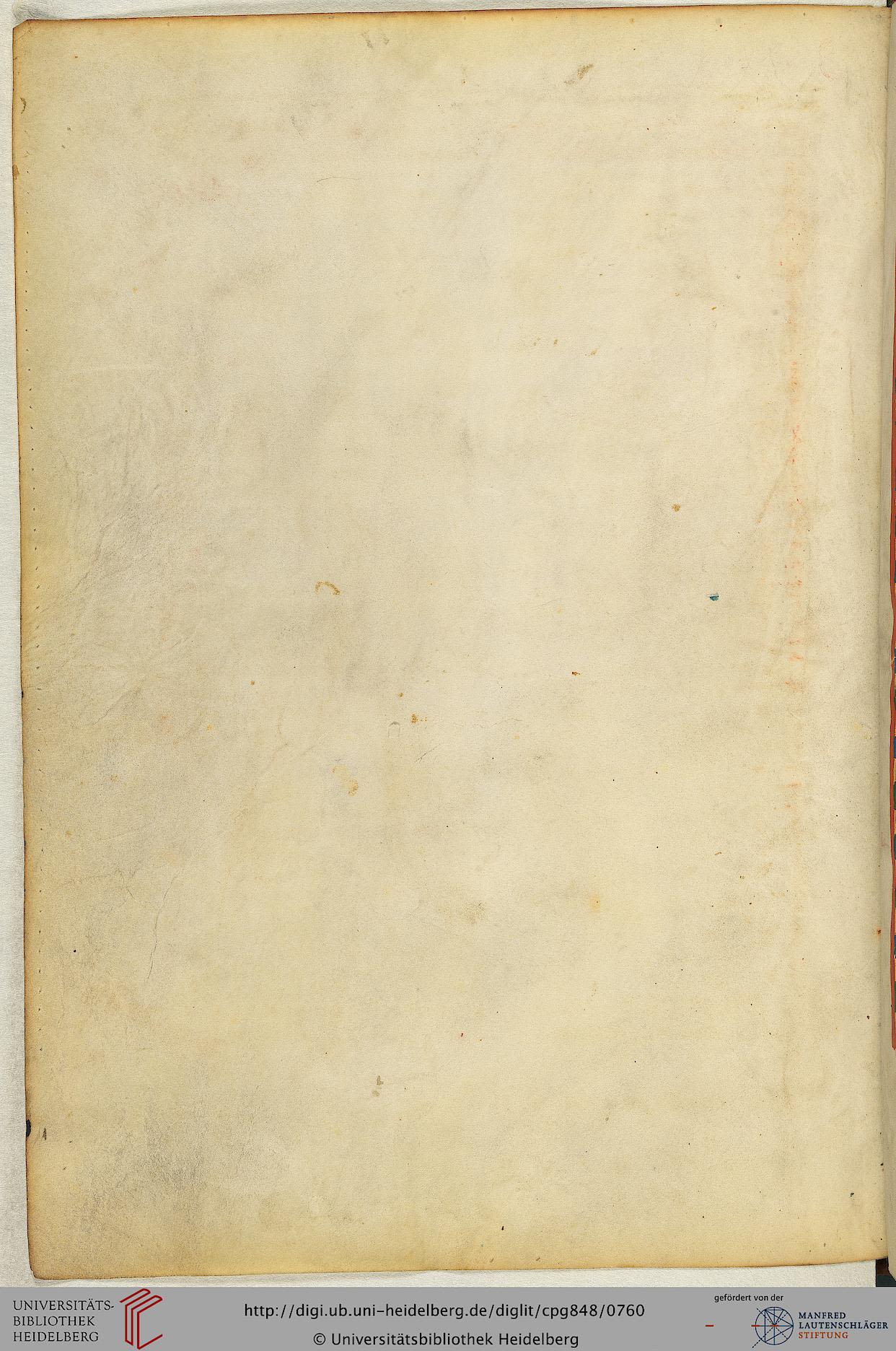
Unter den Dächern von Zürich verbergen sich auch noch nach Hadlaubs Zeiten gebrochene Herzen...
... und auch Jahrhunderte später schmerzt das Herz, manchmal.
Reisen wir von Zürich im Mittelalter ins 21. Jahrhundert nach New York.
Auch hier treffen wir auf Liebeskummer. Nur wird dieser mit anderen Mitteln als Minnesang ausgedrückt: im Film.
Sleepless in New York
Der Schweizer Regisseur Christian Frei ging das Thema Liebeskummer erstmals in einem Dokumentarfilm an. Der eineinhalbstündige Film Sleepless in New York (Produzent: Christian Frei Filmproduktionen GmbH) feierte im April 2014 seine Premiere und wurde an zahlreichen Festivals gezeigt. Frei sagt über sich selbst:
«Ich habe den Ruf, meine Themen in den unzugänglichsten und gefährlichsten Orten der Welt zu finden. In Kriegsgebieten. In Afghanistan und im Weltall. Doch kein Terrain schien mir je so herausfordernd und spannend wie das Thema Liebeskummer. Kaum je zuvor wurde dieses unterschätzte Leiden in einem Dokumentarfilm angegangen. Eigentlich erstaunlich!»
Im Dokumentarfilm begleiten Christian Frei und sein Kameramann Peter Indergand drei Personen aus New York bei ihren schlaflosen Nächten, in denen sie der Liebeskummer wachhält. Alley, Michael und Rosie waren bei Produktionsbeginn gerade von der Liebe ihres Lebens verlassen worden. Auf der Leinwand sehen wir, wie sie der Kummer und die Einsamkeit in der Nacht wachhalten. Wir hören ihre Gedanken, die sich immer wieder um die Person drehen, die ihnen das Herz gebrochen hat und die sie dennoch nicht loslassen können.

«I could see a future with him and now I can’t see anything.»
Zusätzlich zu diesen Aufnahmen der intimen Lebensphase der drei New Yorker beleuchtet die Anthropologin Helen Fisher das Thema Liebeskummer aus wissenschaftlicher Perspektive. Sie erforscht, was im Hirn der an Liebeskummer leidenden Personen abläuft. Ihre Hirnforschung bestätigt:
«When you get rejected in love you still continue to love this person. In fact you love them even harder.»
Interview mit Christian Frei
Im April 2020 durfte ich mit dem Oscar-nominierten Regisseur Christian Frei am Telefon ein Interview durchführen, welches einen Einblick hinter die Kulissen und vor allem auch in Freis anregende Reflexionen über die Liebe und Liebeskummer gibt.
TW: Was hat Sie dazu bewegt, einen Dokumentarfilm über Liebeskummer zu machen?
Christian Frei: Vor einigen Jahren ist mir wegen privater Turbulenzen die Dimension der Liebe auf einmal bewusst geworden. Es hat mich fasziniert und zugleich beängstigt, wie sehr Intelligenz und Vernunft zurücktreten können zu Gunsten von Gefühlen, die man kaum kontrollieren kann. Die Liebe wird allgemein romantisiert und ist auch etwas Wunderschönes, aber es ist mit ihr auch wie bei einer Sucht. Wird die Liebe nicht (mehr) erwidert, möchte man loslassen, schafft es aber nicht – ähnlich wie beim Drogenkonsum. Man ahnt, dass man sich etwas antut, das einem nicht gut tut, aber man kann nicht anders. Ich wollte eine Reise zu dieser unkontrollierbaren, unvernünftigen Dimension der Liebe machen.
Auf Social Media und mit aufgehängten Flyern haben Sie auf Ihr Filmprojekt aufmerksam gemacht. Haben sich viele Leute dazu bereiterklärt, ihren Liebesschmerz dokumentieren zu lassen? Ist ja irgendwie erstaunlich, ein so intimes Erlebnis mit der Öffentlichkeit zu teilen.
Es haben sich etwa 50 Leute bei uns gemeldet – eher junge Leute, mehr Frauen, und einige aus der LGBTQ Szene. Wir haben eine Website eingerichtet, auf der sie wie in einem Tagebuch über ihren Liebeskummer schreiben konnten. Dies wurde rege genutzt. Rosey beispielsweise schrieb Hunderte von Seiten über Monate hinweg! Dies zeigt einerseits das grosse Bedürfnis von Leuten mit Liebeskummer zu reden oder zu schreiben. Andererseits erkläre ich mir die Offenheit damit, dass die Schreibenden uns vertrauten. Sie wussten, dass nur zwei Leute die Einträge lesen würden – nämlich ich und meine Assistentin. Meine Assistentin reagierte jeweils auch sofort, wenn in den Einträgen etwa Selbstmordgedanken geäussert wurden, und kontaktierte die Schreibenden.
Liebeskummer wird in allen möglichen Kunstformen reflektiert. Was ist beim Dokumentarfilms besonders?
Authentizität spielt eine sehr wichtige Rolle im Dokumentarfilm. Doch wie kann man das Gefühl von Einsamkeit, welches einem mitten in der Nacht überfällt, mit einer Filmcrew authentisch festhalten? Dieses Problem habe ich gelöst, indem ich Skype-Gespräche mit Alley durch ihre Computerkamera aufgenommen habe. Ich habe bewusst eine schlechtere Internetverbindung gebraucht, damit die Aufnahmen eine verpixelte Textur bekommen. Wir haben ein paar Nächte lang kurz nach ihrer Trennung durchtelefoniert. Ich habe hauptsächlich zugehört, bis sie eingeschlafen war. Die ersten Sekunden und viele weitere Ausschnitte von diesen Skype-Calls sind in den Film eingebaut. Diese Szenen geben somit Einblick in sehr authentische Momente der Einsamkeit.
Diese authentischen, persönlichen Aufnahmen stehen im Kontrast zu den Forschungsbeiträgen der Anthropologin Helen Fisher. Wieso haben sie einen persönlichen und einen fachlichen Ansatz kombiniert?
Für mich war es sehr wichtig, dass Helen Fisher und ihre Forschung über Liebeskummer einbezogen wurden. Durch ihre Forschung wird eine mögliche Erklärung von dem irrationalen Zustand gegeben.
Fisher hat mit einem MRI-Scanner die Hirne von Menschen im Zustand von Liebeskummer gemacht und herausgefunden, dass die selben Regionen aktiv sind wie bei grösster Verliebtheit. Dies erklärt, warum es uns so schwerfällt, nach einer Trennung den anderen loszulassen. Bei Verliebtheit empfindet man Sehnsucht – Verliebte sind süchtig nacheinander, und es ist ein euphorisches, wunderschönes Gefühl. Wenn man verlassen wird, stürzt man vom siebten Himmel in abgrundtiefe Verzweiflung. Doch die Sehnsucht bleibt oder verstärkt sich sogar noch.
Für mich war dieser Zusammenhang zwischen Hochverliebtheit und Liebeskummer eine der tiefsten Erkenntnisse!
Ein Leitmotiv sind die Szenen in der U-Bahn, in denen Gesichter von verschiedenen Leuten gezeigt werden und mit Voice-over Beiträge aus dem online-Tagebuch vorgelesen werden. Was wollten sie mit diesen Szenen zeigen, und wie haben Sie sie gefilmt?
Die Szenen in der U-Bahn zeigen, wie man inmitten von tausenden von Leuten Einsamkeit fühlen kann. Gerade in der U-Bahn ist man zwar unter vielen Leuten, kommt aber überhaupt nicht in Kontakt mit anderen und ist einsam. Für diese Aufnahmen haben mein Kameramann, Peter Indergand, und ich ein neues Hilfsmittel entwickelt: einen sphärischen Spiegel. Bei diesem sphärischen Spiegel sind die zwei verschiedenen Schärfepunkte von einem geraden Spiegel und einer Kugel kombiniert, sodass das Bild in der Mitte scharf ist und ansonsten weitwinklig. Es war aufwändig, aber es hat sich gelohnt.
Sleepless in New York – wäre es auch möglich gewesen, Liebesschmerz in Zürich darzustellen?
Liebeskummer gibt es überall auf der Welt, in jeder Kultur. Ich habe aber New York ausgewählt, weil es die Hauptstadt der Singles ist. Ausserdem ist die extravertierte Kultur ein grosser Vorteil. Gerade beim Thema Liebeskummer braucht es Offenheit und Bereitschaft, über diese privaten und schmerzvollen Facetten des Lebens zu reflektieren.
Im Film sehen wir, wie die Hauptpersonen kreativ werden und so auch irgendwie ihren Schmerz verarbeiten. Wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen Kunst und Liebeskummer?
Der Zusammenhang ist sehr gross! Liebeskummer kann eine unglaublich produktive Phase auslösen. Mit dem Herzschmerz kommen existenzielle Fragen auf – was mache ich auf der Erde, wie soll ich mein Leben jetzt gestalten? Liebeskummer ist nicht einfach nur schrecklich und lebensgefährlich, sondern enthält eine Dimension, die unglaubliche Kreativität und Energie bewirken. Schliesslich sind in dieser Lebensphase die kostbarsten Werke der Kunst, Musik und Literaturgeschichte entstanden!





In der letzten Szene des Filmes sehen wir Alley beim Zeichnen. Im Voice-over spricht sie ihren Ex-Freund an: «Du bedeutest mir so viel. Und das wird auch so bleiben.» Und der Film endet mit ihren Worten:
«I love you.»
Obwohl den drei New Yorkern das Herz gebrochen wurde, hörten sie nicht auf zu lieben. Noch nach Monaten sind die Gefühle der Liebe für die Person, aber auch der Schmerz, stark. In Hadlaubs Minnelied vergeht die Liebe des Mannes für die Nonne ebenfalls nicht und scheint sogar noch stärker zu werden. Verfügte Hadlaub über die Kenntnis der tiefen Verwandtschaft zwischen Liebe und Liebeskummer, wie sie die aktuelle Hirnforschung herausgearbeitet hat? Seine künstlerische Inszenierung imitiert jedenfalls die Wirklichkeit erstaunlich gut, sogar Gottfried Keller liess sich bereitwillig von ihm täuschen. Und schliesslich liebt auch meine Grossmutter ihren Ehemann noch immer, mit dem sie 54 Jahre verheiratet war und ohne den sie nun seit über einem Jahr leben muss.
Meine Reise hat gezeigt, wie eng Liebe und Leid ineinander verschlungen sind.
Und trotzdem hören wir nicht auf zu lieben und uns nach Liebe zu sehen. Denn vielleicht ist am Ende stärker als das Leid – die Liebe.

Dank
Bedanken möchte ich mich bei Hildegard Keller für ihre Unterstützung und Anregungen für diese Story. Auch meinen Mitstudenten, insbesondere Isabelle Balmer, möchte ich für die Hilfe bei der Entstehung dieser Story danken.
Ein herzliches Dankeschön geht an Christian Frei für das Telefoninterview und das Bereitstellen der Bilder und weiterer Informationen über den Dokumentarfilm.
Gerne möchte ich mich auch bei Max Schiendorfer dafür bedanken, dass er mir seine Tonaufnahme der Minneliedinszenierung zur Verfügung gestellt hat. Seine Forschung über Johannes Hadlaub war zudem eine Grundlage für meine Annäherung an Hadlaub und sein Minnelied in dieser Story.
Quellenangabe
Keller, Gottfried: Hadlaub. In: Züricher Novellen, Stuttgart 1989, S. 18–101.
Schiendorfer, Max (Hg.): Hadlaub, Johannes: Die Gedichte des Zürcher Minnesängers. Zürich/München 1986.
Schiendorfer, Max: Zürich. In: Schubert, Martin. Schreiborte des Mittelalters. Skriptorien – Werke – Mäzene. Berlin/Boston 2013.
Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848
Große Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse): www.digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848.
www.sleepless-in-new-york.com
Bildquellen
Die Fotos vom Codex Manesse sind von der Universitätsbibliothek Heidelberg: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848/0007/thumbs.
Ich habe die Bilder von fol. 371r, 371v und 382v aus dem Codex Manesse verwendet, sowie die Fotos vom Vorderdeckel und Vorderschnitt.
Das Bild von den gemalten Häusern ist ein Ausschnitt aus dem Murerplan, dem Holzschnitt vom mittelalterlichen Zürich von Jos Murer aus dem Jahr 1576. Dies findet sich im Baugeschichtlichen Archiv von Zürich.
Die Fotos von «Sleepless in New York» wurden mir von Christian Frei zur Verfügung gestellt.
Alle anderen Fotos (von Zürich und New York) wurden von Tabea Wolf gemacht.
Dieser Beitrag entstand im Seminar «Die Manesse» bei Prof. Dr. Hildegard Keller (Frühlingssemester 2020) am Deutschen Seminar der Universität Zürich.
