Gesund/Krank
Erster Teil
Ronja Holler, Chiara Jehle und Anna Larcher
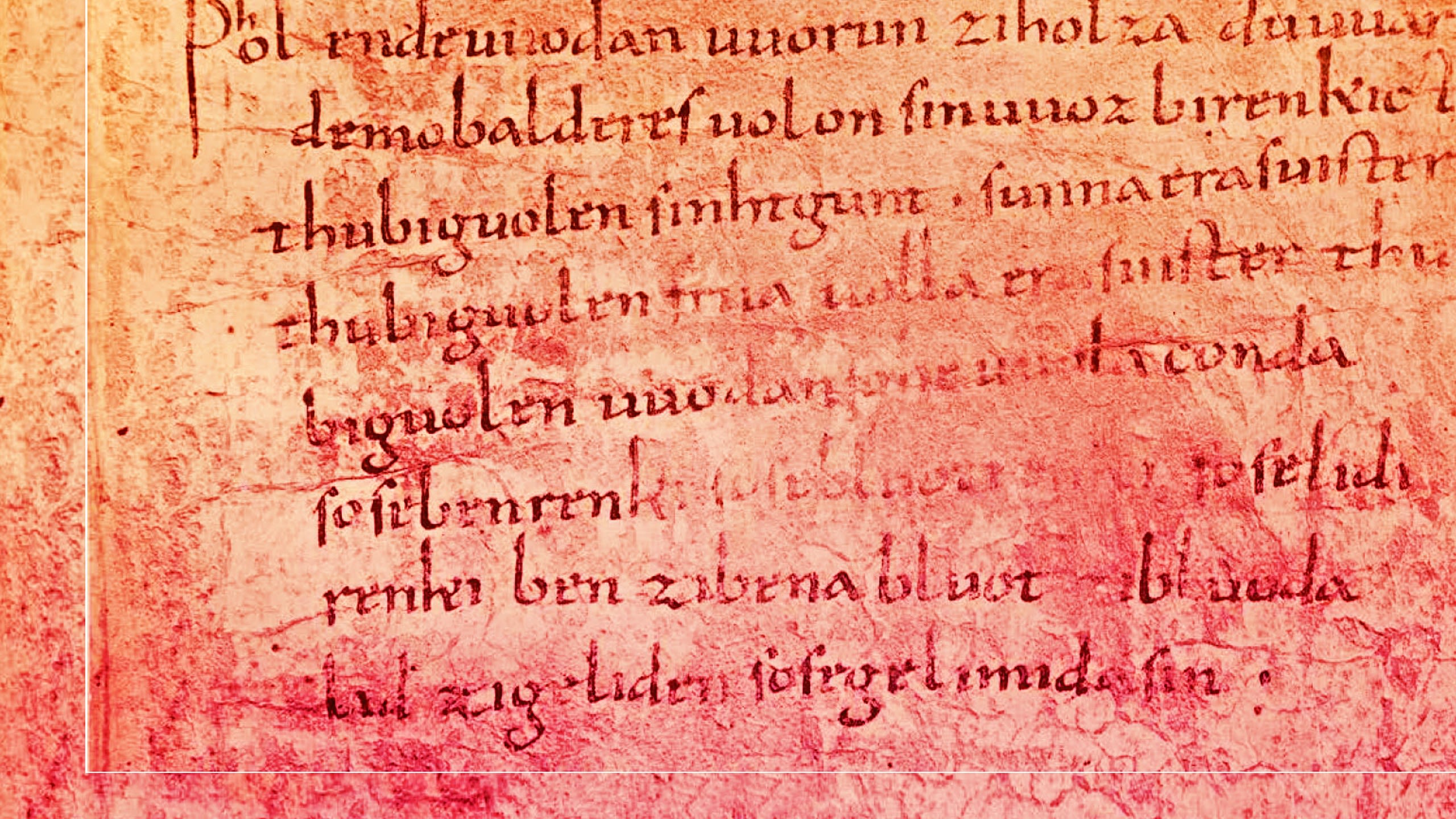
Die Migräne und ich
von Anna Larcher
Es gibt ein Videoaufnahme von mir, da sitzt mein vielleicht fünfjähriges Ich an Grossmutters Tisch und sieht aus wie tausend Jahre alt. Den Kopf in die Hand abgestützt, das Gesicht seltsam zerknittert, um den Mund ein weisses Dreieck.
«Anna, hesch wieder Chopfweh?», fragt mein Vater hinter der Kamera. Meine Kinderaugen schauen matt in die Linse, ich nicke.
Aber Anna hat nicht einfach wieder Chopfweh, sondern Migräne.
Es beginnt mit einer Art Gänsehaut, oft am Nacken, als müsste ich in der nächsten Sekunde erschaudern, doch nichts geschieht. Stattdessen sticht und pocht es hinter der rechten Schläfe, der Druck im Kopf schwillt an, manchmal begleitet mit Übelkeit. Dann geht es rasend schnell: Meine Schädeldecke teilt sich, die zwei losen Hälften wandern auseinander. Der Schmerz schlägt mir seine Zähne ins Gesicht und beisst sich oberhalb meines linken Auges für die nächsten vierundzwanzig bis achtundvierzig Stunden fest. In diesem Zustand ist die Welt da draussen zu laut, zu grell und schmeckt und riecht unerträglich stark.
Die Migräne runs in the family. Sie verhält sich dabei matrilinear. Unzählige Male hat mein Vater meiner Mutter in abgedunkelten Zimmern kalte Waschlappen in den Nacken gelegt und ihr die eiskalten Füsse warm eingepackt. Meine Oma hat nicht Medikamente geschluckt, sondern «g’fressen», wie sie sagt. Und das leider nicht in abgedunkelten Zimmern, sondern als Imkerstochter in der Bienenhütte oder auf dem angrenzenden Acker.
«I hab nua in die Sonne schau’n müassan und do hats scho wieder ang’fangan», erzählt sie in ihrem steirischen Dialekt in der immer selben Formulierung. Bei «do hats scho wieder ang’fangan» reibt sie stets die dicken Finger ihrer rechten Hand aneinander.

Meine Oma hatte ihren ersten Schlaganfall mit 39. In der Nacht sei sie plötzlich aufgewacht und sie schwöre, ihr Kopf habe geraucht. Aber von diesem Moment an hatte sie nie wieder Migräne.
Bei meiner Mutter schlichen sich die Migräneattacken zwar nicht durch die kalten Wickel meines Vaters aus, jedoch durch die Wechseljahre.
Ich bin jetzt sechsundzwanzig. Rechne ich optimistisch, habe ich monatlich 6 Attacken zu 24 Stunden, das ergibt 144 Schmerzstunden. Auch ich fresse Tabletten – gehe nie ohne meine best friends, die Ibuprufens, aus dem Haus. Ich habe mich prophylaktisch durch hochkonzentriertes Magnesium, Epileptika und Anti-Depressiva gekostet. Side effects: von Durchfall, über Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten bis zu Gewichtsverlust. Alles vergeblich.

In einer meiner ersten Uni-Veranstaltung in Geschichte sitze ich an einem Mittwochvormittag im hinteren Drittel des Vorlesungsaals. Ich bin vor fünf Stunden mit Migräne aufgewacht, habe eine Ibu und ein Triptan geschmissen und jetzt eine Medikamentenscheibe vor mir. Die Umwelt dringt nur verzögert zu mir durch, die anderen Studierenden im Saal bewegen sich verlangsamt. So auch mein Mitstudent A., der sich neben mich setzt, als die Professorin das Wort ergreift und sich erst einmal entschuldigt. Sie fühle sich heute nicht gut wegen des Föhnwinds draussen, sie habe solche Kopfschmerzen, als hätte sie gestern eine Flasche Vodka geext. In meinem Verbundenheitsgefühl zu ihr, sage ich leise, aber hörbar, dass auch ich heute Migräne habe. Mein Sitznachbar A. wirkt verwirrt und lacht ein bisschen: «Hä, Migräne isch doch das, was mer am Gymi is Absenzeheftli schriibt, wemer ke Bock uf Sport het.»
Nein.
Migräne ist nicht äfach bitzeli Chopfweh oder ke Luscht uf das, was mer eigentlich müesst mache. Migräne ist eine vererbbare chronische neurologische Erkrankung.
Die erlösende Spritze
Von Chiara Jehle
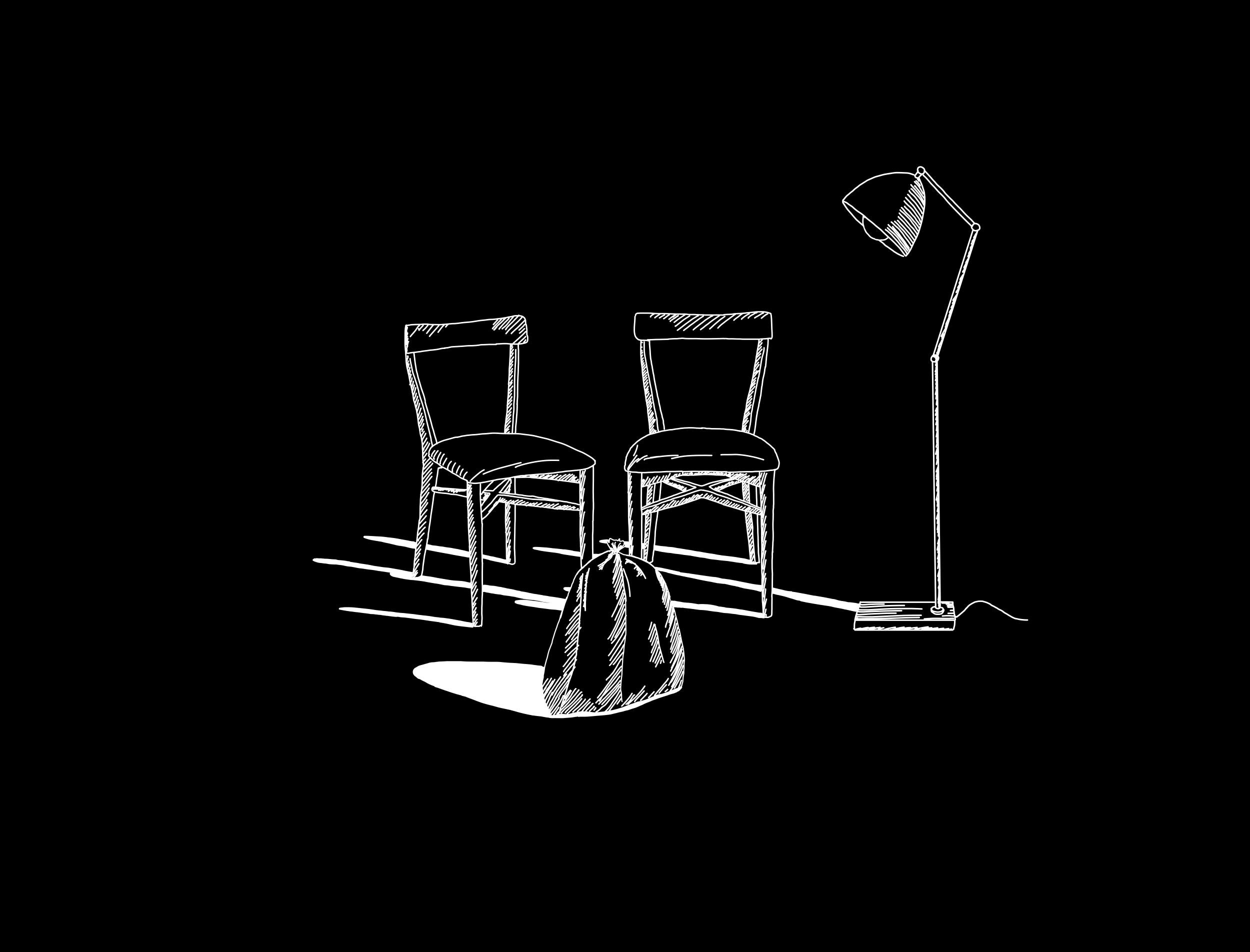
Wer gesund ist, bewegt sich innerhalb der Normalität. Wer nie krank ist, erlebt die Ränder nicht. Wer aber krank ist, erlebt unter Umständen Extreme, die man selbst nie für möglich gehalten hätte.
Ich hatte grosse Angst vor meiner ersten OP. Um 10:30 Uhr checkte ich im Krankenhaus wie an einem Flughafen ein. Um 13:30 Uhr sollte es losgehen. Eine genervte Pflegefachkraft empfing mich. Sie gab mir einen Zettel, den ich unterschreiben sollte, ein Haftungsausschluss im Falle einer Komplikation. Welche Wahl hatte ich schon? Natürlich unterschrieb ich das Dokument.
Die Pflegefachkraft führte mich daraufhin in einen Warteraum: Steril, weiss, kahl. Eine Person sass darin, sie wirkte erregt, vermutlich auch besorgt. Ich setzte mich neben sie. Wir schwiegen. Ich weiss nicht mehr wie lange es ging oder wie es dazu kam, aber wir begannen nach einer Weile verhalten zu sprechen. Sie wartete schon seit Stunden, ihre Operation verzögerte sich nach hinten. Sie war beunruhigt. Die Stimmung war furchtbar.
Irgendwann, ich kann heute nicht mehr sagen, wieviel Zeit inzwischen vergangen war, holte man die Person ab. Sie wurde in eine provisorisch aufgestellte Kabine gebeten. Dort musste sie ihre Kleidung ablegen und einen OP-Mantel anziehen. Dieselbe mürrische Pflegefachkraft wie zuvor reichte ihr einen grünen Abfallsack. Stecken Sie ihre Kleidung hier hinein!
Nun war ich allein in diesem Warteraum, er wirkte inzwischen bedrohlich. Es war bereits 15:30 Uhr, meine Operation hätte vor zwei Stunden stattfinden müssen. Ich sass seit fünf Stunden in diesem Warteraum. Der grüne Abfallsack mit der Kleidung meiner Leidensgenossin lag seit ihrer Abholung zum Bersten vollgestopft inmitten des Raumes. Ich fragte mich, wie die Kleidung darin ihre Besitzerin wiederfinden würde, wo sie nun war, wie es ihr erging. Meine Fantasie erreichte immer tiefere Abgründe, die ich nie für möglich gehalten hätte, Assoziationen, an die ich mich zum Glück nur noch nebulös erinnere.
Als man mich schliesslich nach mehr als sechs Stunden abholte und in den OP-Stuhl einspannte, atmete ich auf. Die Spritze in meine Armvene brachte nicht nur Tiefschlaf, sondern Erlösung. Heute frage ich mich, ob mich das Warten in eine schwarze Trance versetzt hatte.




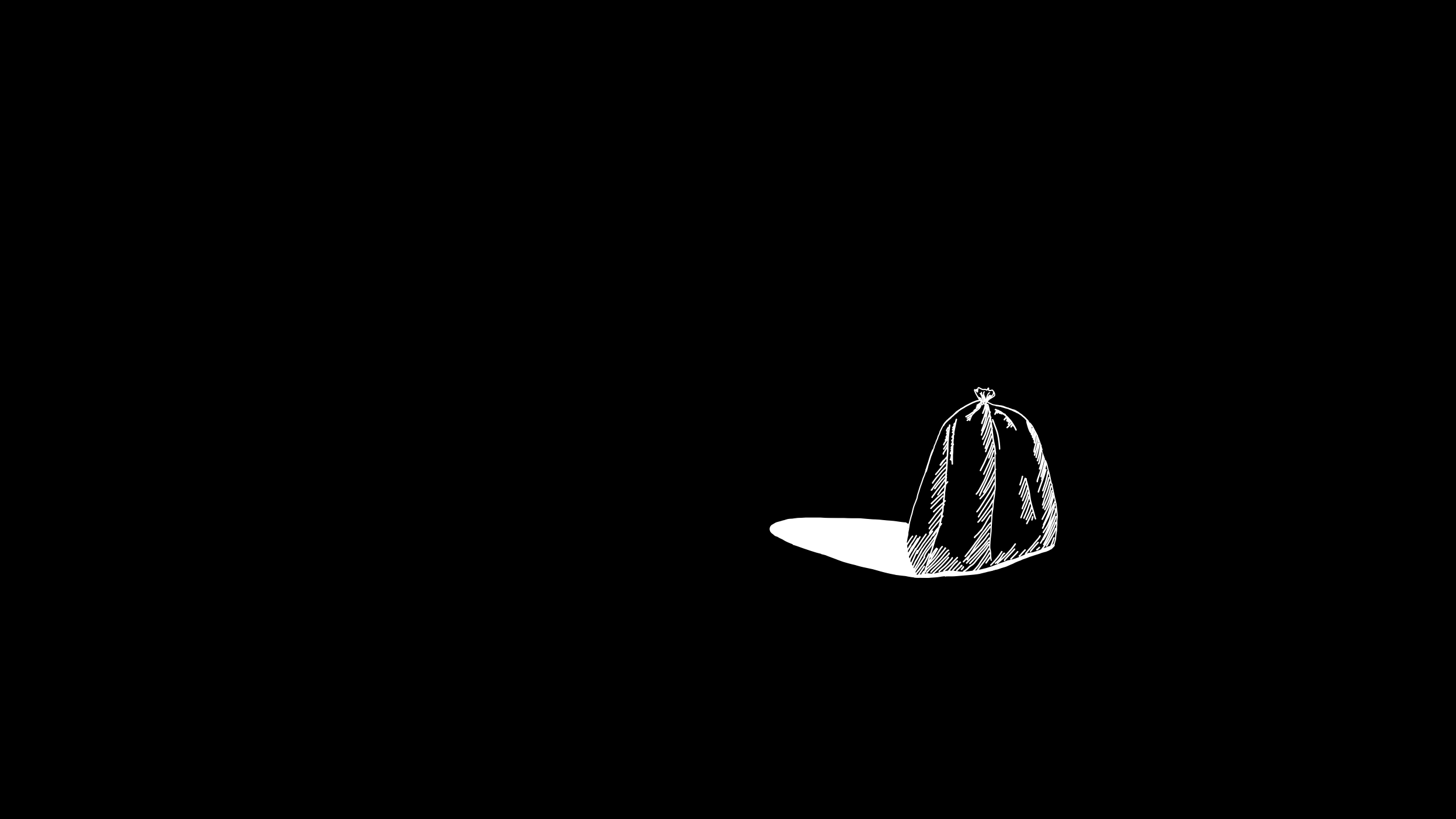
Wo meine Achillesferse wirklich sitzt
Von Ronja Holler

An einem sonnigen, klirrend-kalten Januartag stellte ich mein Snowboard senkrecht zum Berg und fuhr locker kurvend die Piste hinunter. Plötzlich rutschte mir das Brett schneller unter den Füssen weg, als ich mein Gewicht verlagern konnte, und ich plumpste ungelenk auf mein Hinterteil. Ein kurzer, flackernde Schmerz in meinem linken Arm. Es fühlte sich genauso an wie damals, als ich als Kind vom Pferd gefallen und mir den rechten Arm gebrochen hatte. Jetzt war also links an der Reihe. Genau dieselbe Stelle, kurz vor dem Handgelenk. Auf der Piste sitzend, begann ich zu lachen.
Den Arm behelfsmässig stabilisiert, stapfte ich die Piste herunter zur Notfallstelle der Bergbahnstation. Der junge Mann mit der leuchtenden Medic-Weste fragte freundlich, ob ich den Handschuh ausziehen wolle, damit er es sich ansehen könne. «Eigentlich nicht», witzelte ich, zog ihn aber trotzdem aus. Mein Unterarm war auffällig verformt, als wäre er aus Gummi. Der Nothelfer stattete mich mit einer Schiene aus und gab unten in Flims Bescheid, dass ich beim Arzt vorbeikommen würde.
In der Arztpraxis wurde mein lächerlich deformierter Arm geröntgt und war, den amüsierten Reaktionen des medizinischen Personals zu entnehmen, deren Highlight des Tages. Natürlich war er gebrochen. Der Arzt tauschte die Schiene gegen einen Gipsverband und erklärte, dass man den Arm aufgrund meines Alters operieren würde. Bei älteren Menschen dürfe so etwas auch einfach etwas krumm wieder zusammenwachsen. Ich dachte, ich höre nicht recht.



Froh darüber, dass mein Arm nicht entstellt bleiben sollte, stand ich bald darauf vor dem Spital in Ilanz. An der Wand des Notfalleingangs waren bereits zwei Snowboards angelehnt – ich war wohl nicht die Erste heute. Weil ich am selben Tag noch operiert werden würde, gab man mir eines dieser Krankhaushemden und etwas, das aussah wie eine Einweghauben aus der Nahrungsmittelindustrie. Ich identifizierte es schliesslich als Unterhose.
Plötzlich rauschte der Kaiser von Österreich herein. Zumindest machte der riesige, gezwirbelte Schnurrbart des Mannes den Eindruck, er sei direkt dem 19. Jahrhundert entstiegen. Der Habsburger, so stellte es sich heraus, war der Oberarzt, der mich gleich wieder zusammenflicken würde. Ich wurde in den Operationssaal gerollt und hörte noch, wie die Anästhesisten Witze machten, dann ging ich in die Bewusstlosigkeit über.

Was ich für eine Einweghaube hielt, ist eine Unterhose
Was ich für eine Einweghaube hielt, ist eine Unterhose

Der österreichische Kaiser Franz Joseph I. Oder doch ein Oberarzt? Quelle: https://www.habsburger.net/de/personen/habsburger-herrscher/franz-joseph-i
Der österreichische Kaiser Franz Joseph I. Oder doch ein Oberarzt? Quelle: https://www.habsburger.net/de/personen/habsburger-herrscher/franz-joseph-i
Als ich aufwachte, hatte ich vier Titanschrauben und eine Platte mehr im Körper und lag in einem Doppelzimmer am Fenster. Es war bereits dunkel, aber ich konnte erkennen, dass ich Aussicht auf die nahen Berge hatte. «Besser als in Zürich», dachte ich und lächelte. Meine Zimmergenossin, eine rüstige, lebensfrohe Dame, die Rätoromanisch sprach, nickte mir aufmunternd zu. Wir unterhielten uns die folgenden Tage so gut, dass das Pflegepersonal sich erkundigte, ob wir uns bereits vor dem Aufenthalt gekannt hätten. Zwei Tage später wurde ich mit einem Rezept für die Apotheke entlassen. Ich holte mir die Medikamente, die nun einige Wochen meine Mahlzeiten bereichern würden, und ging nach Hause.
Den Arm kann ich Arm mittlerweile wieder gut bewegen. Einzig, wenn es sehr kalt ist, spüre ich manchmal das Titan in meinem Körper. Ich trage nun am rechten und am linken Arm beinahe an derselben Stelle Narben, die davon zeugen, wo meine Achillesferse sitzt: offenbar kurz vor meinem Handgelenk.

