Gottfried Keller – Der träumende Realist
Wie die Videos für die Strauhof-Ausstellung entstanden

Diese Geschichte handelt vom Hunger. Dem Hunger nach gutem Essen, nach spannenden Geschichten und neuen Erfahrungen. Sie handelt aber nicht nur davon, sondern soll den Hunger der Wissbegierigen stillen. Diese Story ist für all jene geschrieben, die sich nicht nur für das Endprodukt interessieren.
Wie kommt ein Baguette aus dem Ofen und wie ein Video in eine Ausstellung? Ich weiss, wie die drei Videos für die Gottfried Keller-Ausstellung im Strauhof produziert wurden. Ich war dabei, als Mitarbeiterin von Bloomlight Productions übernahm ich die Produktionsassistenz.
Quelle: Strauhof.
Quelle: Strauhof.
Als Assistentin von Hildegard Keller, der Seele dieser Videoproduktion, war ich zuständig für manches. Ich war die Bank, die den Interviewpartnern ihren Lohn auszahlte. Ich war die Catering-Fee für die Crew. Ich machte die Transkripte für den Schnitt und schlug im Schnittstudio die Reihenfolge für die Montage vor. Kommen Sie, ich zeige Ihnen die Interviewpartner, die Schauspieler und das Set in Zürich, was es zu essen gab (ohne guten Food kein guter Film) und wie es im Basler Schnittstudio weiterging.
*********
Meine Vorbereitungen für den Drehtag begannen am Vorabend. Die Feinschmeckerin in mir nahm sich das Catering zu Herzen: Ich wollte unserem Team meine Passion für die japanische Esskultur näherbringen. Die Idee war nicht nur gut.
Ich liebe Teriyaki-Sauce (wer die nicht kennt, hat etwas verpasst!) und beschloss, Sandwiches mit dieser Sauce zu machen: Teriyaki Chicken Sub Sandwiches. Ich bereitete die Zutaten am Vorabend zu und ging schlafen. Die Nacht war kurz. Am nächsten Morgen befüllte ich die Baguettes und schob sie in den Ofen.
Mit den frisch gebackenen, in Alufolie eingewickelten Sandwiches stieg ich in den Zug nach Zürich. Erst im Zugabteil bemerkte ich, dass ich die Sandwiches nicht gut genug eingepackt hatte und sich der Duft von Teriyaki-Sauce und Hühnchen im Zug verbreitete. Es war 07:12 Uhr. Ich hätte am liebsten kehrt gemacht.
Um 08:15 stand ich vor dem Strauhof-Museum. Hildegard, die beiden Kameramänner Benno Hofer und Dominik Keller sowie Roman Hess, der Kurator der Ausstellung, bauten gerade das Set auf.

Auch ich packte sofort mit an, erst dann richtete ich mein Büro und meine Cateringstation ein. Der Leiter des Strauhofs, Rémy Jaccard, und sein Team hatten für unsere Mittagspause Platz in ihrem Büro gemacht. Für den Drehtag erklärte sich Ursula Zeller bereit, uns ihr Büro in der James Joyce-Foundation zu überlassen. Das Set war schnell vorbereitet; nun fehlte uns nur noch Julia Weber...
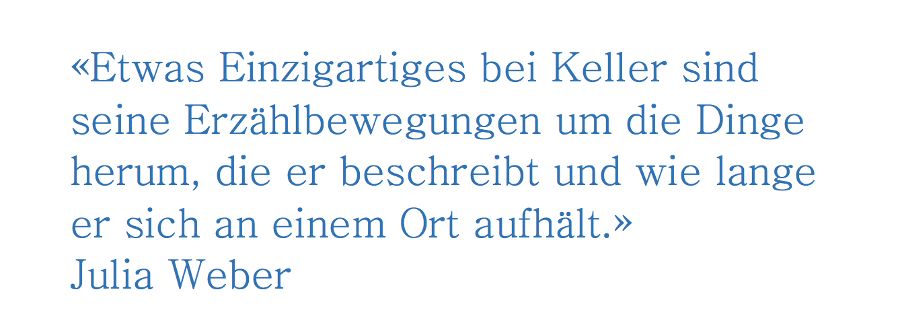
Ein Kribbeln in meinem Magen. Wie würde sie wohl sein, die Julia? Vor dem Dreh googelte ich nach ihr, um vorbereitet zu sein. Literaturdienst, Limmatverlag, SRF Ansichten – Julia ist Google nicht unbekannt. Mit ihrem Roman Immer ist alles schön wurde sie sogar für den Schweizer Buchpreis nominiert. Als ich den Titel las, hoffte ich, dass auch die Begegnung mit ihr schön sein würde.
Kurz nach 9 Uhr traf Julia im Foyer ein. Ich geleitete sie in den zweiten Stock und wollte ihre Jacke abnehmen. Julia war schneller und hängte sie selbst auf. Sie mag Unabhängigkeit. Wir betraten das Set und nach beruhigenden Worten von Hildegard begann das Interview.

Eine Besonderheit von Keller, erzählte uns Julia, ist der liebevolle Blick auf seine Figuren. Als Beispiel erwähnte sie die Figur Johannes Kabis aus der Geschichte Der Schmied seines Glücks. Ich dachte sofort ans Gemüse und fragte mich, ob Keller seine Figur deshalb so benannt hat. Diese Frage klärte sich, als Julia anfing, die Geschichte zu skizzieren:
Johannes lässt sich in John umbenennen, da er denkt, dass ihm auf diese Weise wirtschaftliches Glück wiederfährt. Er bewegt sich weiter durch die Geschichte, das Glück aber lässt sich nicht einfangen. Der Nachname Kabis klingt John zu wenig weltoffen und wichtig, daher wandelt er das i in ein y um. Doch auch diese Massnahme bringt ihm nicht das erhoffte Glück. Schliesslich möchte er das Fräulein Oliva heiraten, findet aber heraus, dass nur ihre Mutter den Namen Oliva trägt und das Fräulein selbst Köpfle heisst. Somit hätte er bei einer Heirat den Namen John Kabys-Köpfle – auf Deutsch Hans Kohlköpfle – erhalten.
Es ging Keller also gar nicht um das Gemüse, sondern um den Unsinn. Jeder Schweizer kennt den Ausdruck «So en chabis!».
«Was mich als Autorin mit ihm verbindet, ist dieser Blick auf die Figuren und diese Beschreibung von Leuten, die nicht gerade durch ihr Leben durchgehen [...], sondern in komischen Kreis- und Stolperbewegungen durchs Leben hindurchgehen. Ich möchte auch ein Leben lang so schreiben und mich bei den Dingen aufhalten, die mir wichtig sind.»
Johannes stolpert durch sein Leben und findet sein Glück auf Umwegen. Nicht die gezielten Namensänderungen führen ihn zum Glück, sondern die Not. Die Geschichte endet damit, dass sich Johannes mit seinem letzten Geld eine Schmiede kauft und er in der einfachen Arbeit sein Glück findet.
Mir ging nach dieser Geschichte der Kabis nicht mehr aus dem Kopf. Dieses Gemüse erinnerte mich an Japan. Sukiyaki, Tsukemono, Okonomiyaki, Tonkatsu – die Liste an japanischen Rezepten, die Kabis beinhalten, liesse sich ewig erweitern. Mein Magen machte sich bei den Gedanken an japanisches Essen bemerkbar, aber der Mittag war noch weit weg.
Nach dem Dreh nahm ich Julia zur Seite. Wir regelten das Geschäftliche, ich begleitete sie hinaus, winkte ihr zu und eilte zurück ans Set.
Nun war Hildegard an der Reihe, denn sie führte nicht nur Regie, sondern war auch als Literaturwissenschaftlerin eine der Interviewpartner. Und da man sich nicht selbst befragen kann, führte ich mein erstes Interview vor laufender Kamera. Ich war vorbereitet, trotzdem liess das Kribbeln nicht nach. Wird meine Stimme zittern? Ich blickte in Hildegards Augen, wir lächelten uns an. Das Kribbeln verschwand. «Wir sind bereit», sagte Dominik. Ich atmete ruhig ein, stellte meine Fragen und erfreute mich an Hildegards Erzählkraft.
Eine Geschichte, die Hildegard erwähnt hat, ist mir besonders geblieben: Zwei Kinder sitzen am Mittagstisch und balgen mit ihren Löffeln um einen Kartoffelstockberg.
Die Schwester ist vif und schnell und frech und gräbt mit ihrem Löffel Tunnel in diesen Kartoffelstockberg. Und der Bruder wird fuchsteufelswild, weil die kleine Schwester ihm immer die Butter abgräbt.
Sie ahnen es schon – es handelt sich um die Erzählung Pankraz, der Schmoller aus dem Novellenzyklus Die Leute von Seldwyla. Damit hatte ich bereits zu tun gehabt. Hildegard führt mit Christof Burkard eine Kolumne im Literarischen Monat und veröffentlichte im Oktober ein Kartoffelstockrezept. Damals zeigte sie mir den Entwurf der Zeichnung. Ich muss zugeben, dass ich das Rezept bis heute nicht ausprobiert habe.
Sie denken sicher, dass sich Kartoffelstock nicht mit Japan verbinden lässt. Da haben Sie sich getäuscht. Es gibt viele Wörter, die die Japaner aus anderen Sprachen übernehmen. Und sie dann häufig so aussprechen, dass man die ursprüngliche Bedeutung nicht mehr erahnen kann. Den Kartoffelstock nennen sie «mashudo poteto», stellvertretend für «mashed potatoes». Es geht noch schwieriger. Was könnte wohl «rentogen» bedeuten? Ein Hinweis folgt beim Mittagessen, die Auflösung am Schluss der Story.
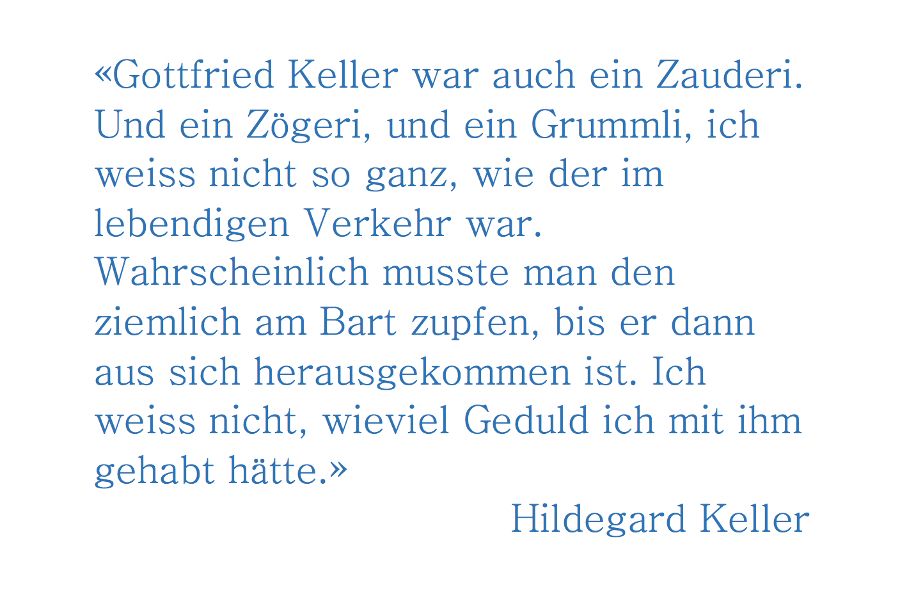


Zwei der vier Interviews waren bereits vorbei. Gespannt erwartete ich den Einsatz des Schauspielers Gottfried Breitfuss. Bei unserem Dreh übernahm er die Rolle von Gottfried Keller, der seine letzte autobiografische Notiz vorstellt – nicht ohne Widerwillen. Ich hatte noch nie einen professionellen Schauspieler am Set erleben dürfen. Als ich ihn erblickte, musste ich schmunzeln. In Natura hatte er tatsächlich etwas von Gottfried Keller – eher klein, mit Bart und Halbglatze. Sein Äusseres war wohl ein Grund, ihn für die Rolle zu engagieren. Vor dem Drehbeginn sprach Hildegard darüber, wie sie sich das Ganze als Regisseurin vorstellte: zwischen Vorlesen und gespielt. Selbst Posen und Gangarten thematisierte sie. Auch Roman Hess, der Gottfried engagiert hatte, redete mit.
Mein Magen knurrte immer lauter. Von einem früheren Dreh wusste ich, dass man das Knurren auf der Tonspur hören kann. Kurzerhand eilte ich in den ersten Stock und holte ein Glas Wasser für Gottfried und Apfelschnitze für die Crew und mich. Klappe zu, Schauspiel ab.

Ich hatte etwas anderes erwartet. Je länger ich den Dreh beobachtete, desto mehr fragte ich mich, ob man daraus ein schönes Video machen kann. Gottfried schien Mühe mit dem Text zu haben, mehr aber noch mit den Regieanweisungen. Was tut man, wenn etwas nicht nach Plan läuft? Weitermachen. Motivieren. Und genau darin liegt eine Stärke von Hildegard.
Trotz der Startschwierigkeiten beendeten wir den Dreh mit Gottfried und verliessen das Set mit einem guten Gefühl.
Nach der Ruhe kommt der Sturm. In unserem Fall: Mona Petri. Sie hat mich umgehauen. Das kommt nicht so leicht vor, ausser beim Thema Japan, aber Monas Leistung begeisterte mich. Mona schlüpfte in die Rolle von Marie Salander, die ihren Kindern ein Märchen erzählt, um sie von ihrem Hunger abzulenken. Das sogenannte Hungermärchen ist in den Roman Martin Salander integriert. Roman hatte es für die Inszenierung mit Mona redigiert, sodass der Sprechtext natürlich wirkte.
Als ich sie in den zweiten Stock führte, wunderte ich mich über ihren Stil. Sie sah anders aus, als auf den Bildern im Internet. Später erfuhr ich, dass sie das Outfit im Brockenhaus gekauft und eine kleine Tasche am Pullover angenäht hatte, um den Denkpfennig verstecken zu können. Marie findet ihn im Roman in einem Kommodenschränklein, aber für diese Szene eine Kommode ans Set zu schleppen, war uns zu aufwändig.

Mona fand eine Lösung – und einen Platz für den Pfennig. Auch das alte Buch, das sie mitbrachte, hat sie zum Requisit umfunktioniert. Darin ist der Text des Hungermärchens versteckt, ausgedruckt und eingeklebt, als Gedächtnisstütze. Was nicht nötig gewesen wäre: Mona konnte den Text des Hungermärchens auswendig.
In einem Rutsch spielte Mona die Szene des Hungermärchens durch. Versprecher gab es kaum. Ihre Augen leuchteten. Der Dreh mit ihr war schnell vorbei, nach zwei, drei Wiederholungen war das Video im Kasten. Ich hätte ihrer Stimme stundenlang zuhören können.

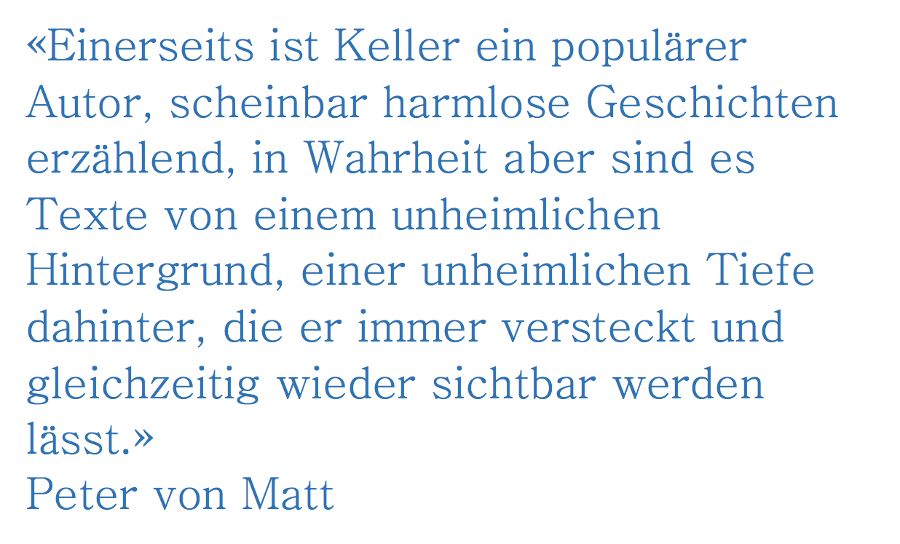
«Ein Herr fragt nach Elena», sagte uns eine Mitarbeiterin vom Museum. Ich fuhr auf, Roman war schneller und erreichte Peter von Matt vor mir. Zu zweit geleiteten wir ihn ans Set, ich nahm ihm die Jacke ab und kämpfte mich durch die am Boden liegenden Taschen, um zur Garderobe zu gelangen. Hildegard war fix, sie startete das Interview, bevor ich mich gesetzt hatte.
Während ich Peter von Matts Ausführungen folgte, fragte ich mich, wie er als Professor an der Universität Zürich war. Ob er sich dort so verständlich und präzise ausgedrückt hat, wie bei unserem Dreh? Dazu sind nicht viele in der Lage.
Während der ersten Minuten erklang immer wieder ein Quietschen. Störende Geräusche kannten wir – Glasklirren, laute Gespräche, Scheppern und anderes – aber das war neu. Es waren die Schuhe von Peter von Matt. Sobald er mit den Füssen wippte, quietschte es. Wir legten ihm eine Matte unter die Füsse, die sieht man in den Filmszenen natürlich nicht und das Geräusch war eliminiert.

Peter von Matt erzählte, dass der Gedichtzyklus Lebendig begraben für ihn einer der faszinierenderen Texte von Gottfried Keller ist. Keller stellt sich in diesem Zyklus als lebendig Begrabenen dar und beschreibt seine letzten Tage, die er im Sarg verbringt. Eine Situation, die ich mir lieber nicht vorstellen möchte. Das Eingesperrtsein scheint aber ein Kernthema von Keller zu sein:
«Das Eingesperrtsein, das in der Tiefe eingeschlossen sein, das ist ein Lebensmythos von ihm. Auch in einem der berühmtesten Gedichte «Die Winternacht» ist es die Seejungfrau, eine Projektion seiner eigenen Existenz, die unter dem Eis eingefroren ist. Und dahinter steht natürlich zuletzt immer dieses Abgesperrtsein von der Liebe, nach der er sich sehnt.»
Ob sich Keller in seiner eigenen Existenz wirklich eingesperrt fühlte? Die Geschichten über Keller im Wirtshaus eröffneten mir eine ganz andere Perspektive. Keller, so Peter von Matt, hatte drei Phasen in einem Wirtshaus. Während der ersten Phase sass Keller stumm da, in der zweiten blühte er auf und erzählte spannende Geschichten. In der dritten Phase aber wurde er böse und aggressiv: Beleidigungen und Tätlichkeiten – selbst gegen seine Freunde – waren nicht unüblich. Keller soll deswegen schon aus einem Gasthof rausgeworfen worden sein.
Quelle: Zentralbibliothek Zürich, GKN 306 c.
Quelle: Zentralbibliothek Zürich, GKN 306 c.
Keller konnte sich aber auch von der Aussenwelt abschotten. Wenn Keller sich in seiner Schwermut zurückzog und einrichtete, sass er zuhause, trank Tee und schimpfte mit seiner Schwester, erzählte von Matt.
«Die Fatalität seiner Existenz ist schon beklemmend. Dieses hin und her von Festlichkeit und Verschattung, das ist nicht eine lustige Abwechslung, sondern immer ein Sturz vom einen ins andere.»
Für mich klingt das nach bipolarer Störung. Oder spitzte von Matt die Stimmungsschwankungen nicht doch etwas zu?
Eine Interviewfrage führte zur nächsten. Hildegard war gepackt, der Fundus ihres Kollegen schien unerschöpflich, und die Abmachung, jedem Interviewpartner die drei gleichen Fragen zu stellen, trat in den Hintergrund. Von Matt aber hatte mitgezählt. „Das waren ja schon sieben Fragen!“ Hildegard lachte und erwiderte: „Du weisst so viel, ich konnte nicht aufhören.“ Sie beendete das Interview und ich gab Peter von Matt die gewünschten Kopien der Geschäftsdokumente.
Peter Bichsel traf zu früh ein und stiess auf Peter von Matt. Hildegard winkte mir, ich sollte die Begegnung der zwei Freunde fotografieren. Verwundert zückte ich mein Handy.

Nach einigen Worten verliess von Matt das Set, ich reichte ihm seinen Mantel und geleitete ihn hinaus. Erst nach diesem Trubel bemerkte ich, dass Bichsel ein Buch mitgebracht hatte. Es war der Martin Salander. Er legte den Roman neben sich auf die Holzbank und Hildegard startete das Interview.
Bereits während der ersten Minuten schlug er das Buch auf und las den ersten Satz vor: Ein noch nicht bejahrter Mann, wohl gekleidet und eine Reisetasche von englischer Lederarbeit umgehängt, ging von einem Bahnhofe der helvetischen Stadt Münsterburg weg, auf neuen Strassen, nicht in die Stadt hinein, sondern sofort in einer bestimmten Richtung nach einem Punkte der Umgegend, gleich einem, der am Orte bekannt und seiner Sache sicher ist.
Ein langer, schleppender Satz, der im Rhythmus des alten Zürichdeutsch geschrieben sei, erzählte uns Peter Bichsel. Ich lächelte in mich hinein und dachte, dass auch er den alten Zürcher Rhythmus beherrscht. Langsam, bedächtig, überlegt; so würde ich Bichsels Sprechweise beschreiben. Dafür soll er berühmt sein, erfuhr ich im Nachhinein.

Und dann schlug er einen Bogen zum Rotwein. Denn während des Lesens von Martin Salander, so Bichsel, ergreife ihn bereits bei den ersten Zeilen das Bedürfnis, Wein zu trinken. Ich musste erneut schmunzeln. Während der Keller-Lektüre hatte ich bis anhin noch nie ans Rotweintrinken gedacht. Aber wie Peter Bichsel so schön formulierte:
«Es gibt in diesem Augenblick des Lesens nur zwei Gerechte auf dieser Welt. Der Autor und der Leser. Wir zwei wissen was da läuft.»
Ein langer Tag ging zu Ende. Ich zahlte Bichsel sein Honorar und half der Crew beim Abbau des Sets. Der Dreh war ein Erfolg, ich fuhr erleichtert nach Hause. Im Zug nach Frauenfeld dachte ich über die zwei Gerechten nach. Im Augenblick des Essens gibt es ebenfalls nur zwei Gerechte auf der Welt. Den Koch und den Geniesser. Wobei man auch beides gleichzeitig sein kann – ich jedenfalls möchte beides nicht missen. Jetzt aber freute ich mich darauf, nur zu geniessen. Mamas Essen schmeckt mir nämlich immer noch am besten!
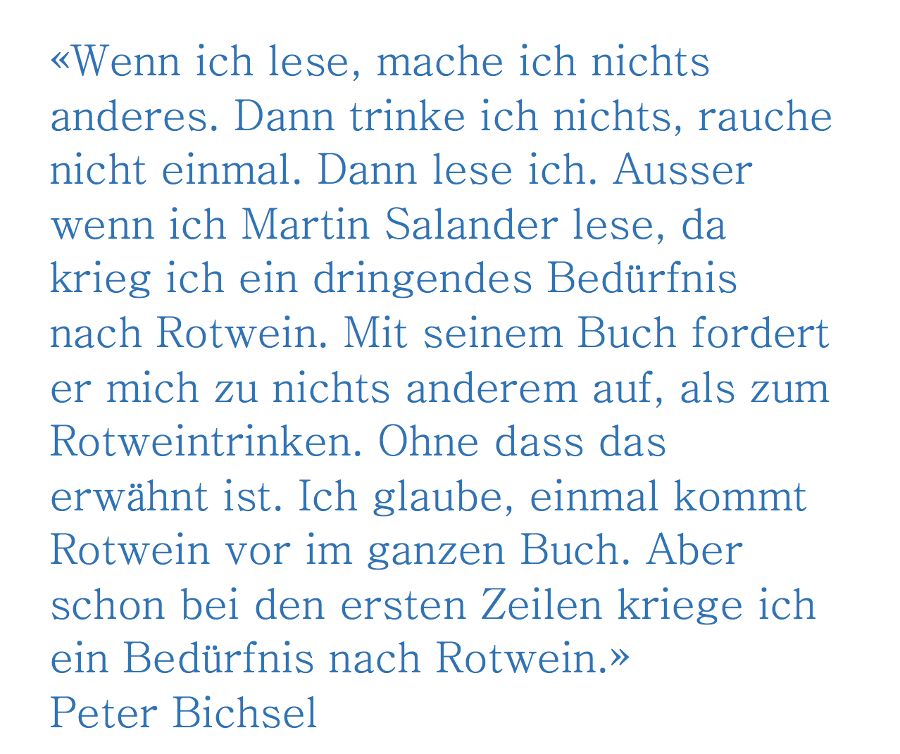

Tropfen rannen an der Fensterscheibe herab. Der 12. Januar war ein stürmischer Sonntag. In höher gelegenen Gebieten schneite es, in tieferen fiel Regen. Eigentlich ein perfekter Tag, um sich zuhause zu entspannen. Ich aber sass vor dem Laptop und erstellte die Transkripte der vier Interviews. Bereits am folgenden Dienstag und Mittwoch war der Schnitt der Videos geplant. Transkripte erleichtern diese Arbeit enorm. Damit weiss man genau, an welcher Stelle im Video welche Aussage gemacht wurde. Das erübrigt das Suchen, womit man beim Schneiden kostbare Zeit verlieren kann.
Und dann fuhr ich nach Basel. In der Nähe des germanistischen Instituts befindet sich das Schnittstudio von Benno.
Als ich eintraf, sassen Benno und Hildegard vor den Bildschirmen und beendeten gerade den Schnitt des Videos mit Gottfried. Dann bearbeitete Benno die Szene mit Mona – ihre Sequenzen waren beinahe perfekt.

Die kniffligste Montage war die Zusammensetzung der vier Interviews. Meine Transkripte waren die Grundlage für die anspruchsvolle Aufgabe. Wie beginnt man ein solches Video? Am besten mit einer Kernfrage! Bichsel hatte eine von Hildegards Fragen wiederholt: «Ja, was ist Keller?». Von diesem Ausgangspunkt her schlängelten wir uns durch die spannendsten Aussagen des Interviews. Ich suchte in den Transkripten passende Stellen und schlug eine mögliche Reihenfolge vor.
*********
Ein paar Wochen später bekam ich eine E-mail von Philip, dem stellvertretenden Leiter des Strauhofs, die mich freute. Solche E-mails bekomme ich selten. Er lud mich zur Vernissage mit anschliessendem Essen ein. An der Vernissage sah ich zum ersten Mal die fertiggestellten Videos. Ich empfand Stolz und Freude. Ich hoffe, dass auch Sie die Ausstellung sehen und geniessen konnten!
So – und nun die Auflösung meines japanischen Rätsels: «rentogen» meint röntgen. Sie fragen sich jetzt, was Gottfried Keller und die Röntgenstrahlen miteinander zu tun haben? Ihr Entdecker Röntgen und Keller waren Zeitgenossen. Er entdeckte die Strahlen fünf Jahre nach Kellers Tod.
Das Nachleben: Das Interview-Video wurde im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt! In der SRF-Sternstunde über Gottfried Keller war ein Einspieler des Videos zu sehen.
*********
Die Aufnahmen von den Dreharbeiten gehören Bloomlight Productions und dürfen unter Nennung der Quelle verwendet werden.
Dieser Beitrag entstand im Seminar Gottfried Keller und das Zürcher Mittelalter (Prof. Dr. Hildegard Keller, Frühlingssemester 2019) am Deutschen Seminar der Universität Zürich.



